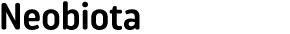Zahl der Neophyten stark gestiegen
In Österreich wachsen schon über 1.600 Pflanzenarten, die ursprünglich aus anderen Regionen der Welt stammen. Das zeigt die neue Neophyten-Checkliste der Universität Wien. Vor allem die steigenden Temperaturen sorgen laut Fachleuten dafür, dass sich die gebietsfremden Pflanzen auch in den heimischen Ökosystemen zunehmend wohlfühlen.

Ragweed und Götterbaum gehören mittlerweile wohl zu den bekanntesten Neophyten in Österreich. Ragweed stammt ursprünglich aus Nordamerika, der Götterbaum aus Asien – trotzdem konnten sich beide Pflanzenarten auch in Österreich ausbreiten.
Neophyten-Checkliste der Universität Wien
Eine neue Checkliste der Universität Wien zeigt nun, dass in den vergangenen zwei Jahrzehnten knapp 550 weitere Neophyten in den heimischen Ökosystemen gefunden wurden – 94 davon konnten sich bereits dauerhaft etablieren. Insgesamt sind in der neuen Checkliste somit schon über 1.600 gebietsfremde Pflanzenarten verzeichnet, was rund der Hälfte der österreichischen Flora entspricht.
Klima und globale Vernetzung
„Das wärmere Klima macht es vielen Arten überhaupt erst möglich, sich hier anzusiedeln“, erklärt der für die neue Checkliste hauptverantwortliche Ökologe Michael Glaser im Gespräch mit ORF Wissen. „Viele Pflanzen, denen es früher im Winter bei uns viel zu kalt gewesen wäre, kommen mit den klimatischen Bedingungen in Österreich mittlerweile ganz gut zurecht.“
Aber auch die stärkere globale Vernetzung durch Reisen und vor allem auch den Handel spiele eine Rolle. „Man muss nur mal in den Baumarkt gehen und sich die Zierpflanzen anschauen, die dort verkauft werden.“ Einige davon würden in Österreich eigentlich nicht wachsen, weil sie aber als besonders widerstandsfähig gelten, werden sie dennoch eingepflanzt. „Gerade weil eben meist auf so widerstandsfähige Pflanzen gesetzt wird, kann man dann kaum verhindern, dass sie sich weiter ausbreiten, und man wird sie oft auch nur sehr schwer wieder los“, so Glaser.
Heimische Arten werden verdrängt
Einige der Neophyten erschweren den Alltag von Allergikerinnen und Allergikern, wie etwa auch das Ragweed und der Götterbaum. Andere gebietsfremde Pflanzenarten haben hingegen gravierende Auswirkungen auf die Biodiversität, indem sie andere Pflanzen am Wachsen hindern. „Da gibt es zum Beispiel die Robinie, bzw. die ‚falsche Akazie‘, die ursprünglich aus Nordamerika stammt“, so der Ökologe. Gegenüber in Österreich heimischen Pflanzenarten hat die Robinie den Vorteil, dass sie sehr schnellwüchsig ist und sich selbst düngen kann.
Die vielen Nährstoffe, die die Robinie dabei in den Boden einbringt, sind für viele heimische Pflanzen aber problematisch. „Sie düngt diese Flächen nachhaltig, das heißt die Arten, die an niedrigere Nährstoffkonzentrationen angepasst waren, können sich dann dort nicht mehr ansiedeln und die Lebensräume werden somit nachhaltig zerstört.“ Die Bekämpfung der Robinie ist außerdem sehr kostspielig und mühsam, denn die Pflanze kann sowohl als hoher Baum als auch als kleiner Strauch wachsen, was es deutlich erschwert, sie vollständig aus einem Ökosystem zu entfernen.
Frühzeitiges Handeln entscheidend
Weil die Robinie auch ganze Waldbestände bilden kann und dabei den in Österreich heimischen Bäumen schadet, kann sie unter anderem für Ertragsverluste in der Forstwirtschaft sorgen. „Bei solchen Pflanzen wäre es daher wichtig, nach dem Vorsichtsprinzip zu handeln“, so Glaser.
Damit meint der Ökologe, die Ausbreitung derartiger Neophyten streng zu kontrollieren und die Jungpflanzen idealerweise schon zu bekämpfen, bevor sich die Pflanzenart tatsächlich in einem Ökosystem etablieren kann. „Frühzeitiges Handeln ist entscheidend“, so Glaser. „Je schneller problematische Arten erkannt und Gegenmaßnahmen ergriffen werden, desto größer sind die Chancen, gravierende Schäden und hohe Kosten zu vermeiden.“
Das sei vor allem auch bei unbekannteren Neophyten wichtig, die sich in Österreich noch nicht großflächig ausbreiten konnten, etwa bei der Paulownia bzw. dem Blauglockenbaum, der zurzeit vor allem noch in österreichischen Städten wächst, zunehmend aber auch in ländlichen Gebieten zu finden ist. „Die Paulownia ist da vom Trend her sehr ähnlich zum Götterbaum. Also es gibt zuerst eine relativ rasante Ausbreitung in der Stadt, die dann auch auf den ländlichen Raum übergeht. Und die Sorge ist eben, dass die Art wie der Götterbaum sehr invasiv werden könnte. In Südeuropa ist sie daher in manchen Ländern auch schon als potenziell invasiv eingestuft.“
Grundlage für Politik und Naturschutz
Die neue Neophyten-Checkliste der Universität Wien soll laut Glaser daher nicht nur als wissenschaftliche Bestandsaufnahme dienen, sondern auch als Werkzeug für die Politik und den Naturschutz. Durch Prävention und Monitoring sollen zukünftige Invasionen verhindert werden. Glaser empfiehlt außerdem, die Einführung neuer Pflanzenarten, etwa als Zierpflanzen im eigenen Garten, sehr kritisch zu hinterfragen: „Die menschliche Verantwortung ist entscheidend, da viele dieser Pflanzen zuerst in Gärten oder landwirtschaftliche Flächen eingebracht werden, von wo sie sich dann weiter ausbreiten.“
Quelle
Ragweed & Co: Zahl der Neophyten stark gestiegen - science.ORF.at