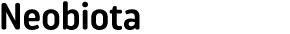Gärtnern für die Artenvielfalt: Warum ein Verein eine einzige Pflanze ausrotten will
Barbara Moser und Edwin Herzberger lieben Pflanzen. Trotzdem bekämpfen sie den Japanischen Staudenknöterich.
Gemächlich plätschert der Laabenbach durch Neulengbach in Niederösterreich. Üppige Vegetation hat sich an den Uferböschungen breitgemacht. Auf den ersten Blick scheint es, als wäre die ökologische Welt hier noch im Gleichgewicht – wäre da nicht Edwin Herzberger. Hüfttief steht er zwischen Büschen und schneidet Pflanzen mit einer Sense um.

Was für Laien im ersten Moment befremdlich wirken mag, ist in Wirklichkeit ein Wettlauf gegen die Zeit. Denn Neulengbach hat, wie ganz Österreich, ein Problem – den Japanischen Staudenknöterich. Eine invasive Pflanze, die alles zu überwuchern droht – mit schwerwiegenden Folgen.
Kampf gegen den Knöterich
Bereits im 19. Jahrhundert wurde der Knöterich von Nordostasien als Zier- und Futterpflanze nach Mitteleuropa gebracht. In Österreich breitet er sich als invasiver Neophyt in allen neun Bundesländern aus. Wo er sich etabliert, haben heimische Pflanzen wie Schafgarbe, Johanniskraut und Königskerze kaum noch eine Chance. Bis zu 70 Prozent kann der Verlust der Artenvielfalt an befallenen Standorten ausmachen.
"Wie massiv der Staudenknöterich an einigen Stellen werden kann, ist mir erstmals bewusst geworden, als ich nach Neulengbach gezogen bin", erzählt Herzberger von seinen frühen Erfahrungen mit dem Neophyten. Er arbeitet am Bundesforschungszentrum für Wald und hat es sich privat zur Lebensaufgabe gemacht, den Knöterich zu bekämpfen, wo immer er kann. Hunderte Stunden hat er bereits in diese Sisyphusarbeit investiert.
Unterstützung bekommt er mittlerweile von Barbara Moser. Auch sie hat das Problem erkannt und Anfang 2025 den Verein Wurzelwerk gegründet. Ihr selbsterklärtes Ziel: auf das Problem aufmerksam machen und Menschen dazu animieren, kleine Aufkommen gleich selbst zu entfernen, bevor sie überhandnehmen.
Um zu zeigen, dass es dafür keine besonderen Vorkenntnisse benötigt, veranstaltet sie regelmäßig Treffen, bei denen engagierte Bürgerinnen und Bürger in ihrer Freizeit dem Knöterich – bewaffnet mit Gartenhandschuhen, Baumscheren und Schaufel – an die Wurzel gehen. Sie beschreibt das als "Gärtnern für die Artenvielfalt". Denn um das Gleichgewicht zu halten, müsse man eben entfernen, was zu viel sei – "wie im eigenen Garten".
Wüterich
Die erfolgreiche Ausbreitung hat der Japanische Staudenknöterich vor allem seinen sogenannten Rhizomen zu verdanken: einem leistungsfähigen unterirdischen Ausläufersystem, über das er sich rasant vermehrt. Das macht auch seine Bekämpfung so schwierig. Denn bleibt nur eines dieser Rhizome in der Erde zurück, kann es auf einer Länge von bis zu zehn Metern schnell hunderte neue Triebe ausbilden und so wieder dichte Bestände etablieren.
Der Klimawandel trägt mit den immer höher werdenden Temperaturen sein Übriges zum rasanten Wachstum des Neophyten bei. Unter optimalen Bedingungen kann er pro Tag 30 Zentimeter wachsen und dabei eine Höhe von über drei Metern erreichen. Die heimische Pflanzenwelt kann mit diesem Tempo und dem dichten, buschigen Blätterdach des Knöterichs nicht mithalten – im Kampf ums Sonnenlicht ein Todesurteil.
Wirtschaftlicher Schaden
Doch der Schaden beschränkt sich nicht auf die Natur. Auch wirtschaftlich verursacht der Knöterich veritable Kosten. Gebäude, Brücken, Asphalt – seine Wurzeln können selbst in kleinste Zwischenräume eindringen und durch ihr schnelles Wachstum in die Breite erhebliche Zerstörung anrichten.
Hinzu kommen Mehrkosten für die Bekämpfung großer Bestände an Hochwasserschutzdämmen, Gleisanlagen, Straßen und in der Landwirtschaft. Konkrete Zahlen, wie hoch der Schaden durch den Knöterich hierzulande tatsächlich ist, gibt es allerdings nicht, bestätigt Wolfgang Rabitsch vom Team Biologische Vielfalt & Naturschutz am Umweltbundesamt auf Nachfrage.
Kehrtwende
Weltweit sind invasive Arten einer der Hauptgründe für den Rückgang der Biodiversität. Den Japanischen Staudenknöterich listet die International Union for Conservation of Nature (IUCN) als eine der "100 of the World's Worst Invasive Alien Species". Der Naturschutzbund Österreich verlieh ihm im Jahr 2024 den Titel " Alien des Jahres", und auch Wolfgang Rabitsch (Umweltbundesamt) stuft den Knöterich aus wissenschaftlicher Sicht als "eine der invasivsten und problematischsten Pflanzenarten" ein.
Auf der "Unionsliste der invasiven Neophyten", die erstmals 2016 von der Europäischen Union veröffentlicht wurde, fehlt er trotzdem – zumindest noch. Diese Liste umfasst derzeit 88 invasive Tier- und Pflanzenarten, die in der EU nicht eingeführt, in Verkehr gebracht oder in der Umwelt freigesetzt werden dürfen. 16 der dort gelisteten Pflanzen kommen auch in Österreich vor, darunter Götterbaum, Riesen-Bärenklaue und Drüsiges Springkraut.
Auf Antrag der Niederlande wird ab Herbst auch der Japanische Staudenknöterich samt seiner weniger verbreiteten Verwandten Sachalin-Knöterich und Böhmischer Knöterich in den Index der EU aufgenommen. Die Einschränkungen im Umgang mit dem Knöterich sind dann auch in Österreich anzuwenden. Innerhalb von drei Jahren muss zudem der nationale Aktionsplan für gebietsfremde invasive Arten angepasst werden. Er gibt auch Maßnahmen vor, wie die weitere Einbringung und Ausbreitung dieser Arten eingeschränkt werden kann.
Gekommen, um zu bleiben
Dass es der Knöterich nicht schon früher auf die Liste geschafft hat, ist dem Widerstand einiger Mitgliedsstaaten geschuldet. Sie befürchteten, dass die Beseitigung schlicht zu aufwendig wäre. Ein Argument, das Edwin Herzberger besonders sauer aufstößt: "Hätte man damals früher und anders reagiert, hätte man das Problem durchaus noch in den Griff bekommen können", beklagt er und verweist auf die Schweiz, wo der Knöterich bereits seit längerem auf einer schwarzen Liste steht, also verboten ist.
Er sieht in dieser "Augen-zu-Mentalität" Parallelen zum aktuellen Umgang mit der Klimakrise: "Solange man es noch nicht merkt, ist es noch kein Problem." Ganz verschwinden wird der Knöterich allerdings auch mit der neuen EU-Verordnung nicht mehr. Dafür sei er einfach schon zu weit verbreitet, gibt Rabitsch zu bedenken: "Man wird sich überlegen müssen, wie man die Ressourcen zur Beseitigung dann am besten einteilt. Wahrscheinlich wird es sich auf kleinere Vorkommen in Gebieten mit hohem Naturschutzwert konzentrieren."
Dass der Knöterich gekommen ist, um zu bleiben, haben auch Herzberger und Moser akzeptiert. Für sie geht es bei ihrem Engagement nicht mehr um die Ausrottung, sondern nur noch um die Eindämmung der weiteren Ausbreitung. Dass es gelingen kann, haben sie in Neulengbach am Uferabschnitt vor dem Borg gezeigt. Wo vor einem Jahr noch der Knöterich gewütet hat, wachsen heute wieder heimische Pflanzen.
"Für mich ist das hier eine exemplarische Fläche, um zu zeigen, was man mit begrenzten Mitteln und Aufwand erreichen kann", beschreibt es Moser. In Zukunft sieht sie auch die Politik in der Verantwortung und stellt klar: "Es darf nicht nur das Hobby von ein paar Idealisten sein – es geht uns alle etwas an!"
Quelle
Pressemitteilung DerStandard vom 3. August 2025